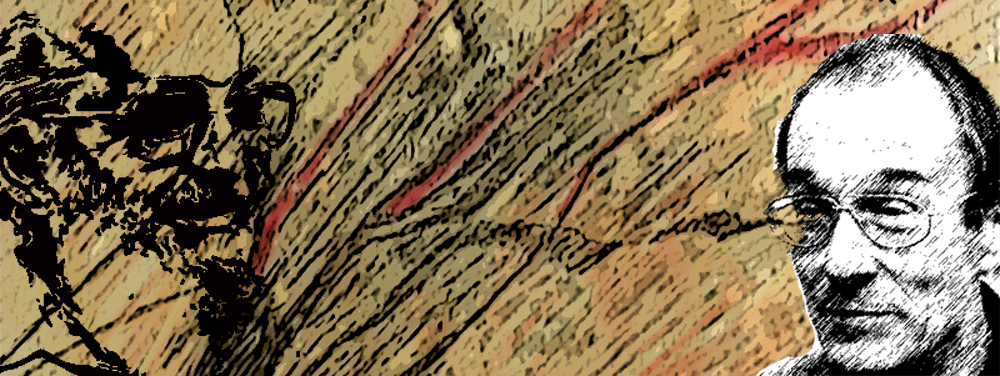Die kritisch-pragmatische, emanzipatorische Lerntheorie orientiert sich unter anderem an den Konzepten der „Pädagogik der Befreiung“ von Paulo Freire, an Peter Faulstichs kritisch pragmatistischer Lerntheorie und der kritischen Psychologie Klaus Holzkamps. Hier versuche ich, meine Erfahrungen mit offenem, fächerübergreifendem und projektorientiertem, dialogischem Unterricht in der Praxis (Hauptschulabschlusskurse) durch meine Tätigkeit als Lehrkraft im zweiten Bildungsweg, mit Hilfe dieser Theorie zu reflektieren.
Befreiende Bildung
Haben wir es im Bereich der Hauptschulabschlusskurse denn mit Gefangenen zu tun oder warum ist von Befreiung die Rede?
Unser Auftrag leitet sich aus der Verordnung über Nichtschülerprüfungen in Niedersachsen und dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) ab. Darin sind jeweils „Mündige Bürger“, „Lebenslanges Lernen“, „der Lebenswirklichkeit gerecht werden“ und „Emanzipation und Inklusion“ als Ziel gebende Stichworte enthalten.
Um den darin umrissenen Zielen gerecht zu werden, müssen wir bei der Heterogenität unserer Gruppen sehr grundlegend ansetzen, aber auch individuellen (Lern-) Bedürfnissen entsprechen und ein weit über den Hauptschulabschluss hinausweisendes Ergebnis anstreben.
Den Hauptschulabschluss selbst sehe ich hier als Mittel zum Zweck: Damit die Teilnehmenden am Ende der Maßnahme eine Bestätigung des Gelernten, eine persönliche und formelle Anerkennung und ein Erfolgserlebnis haben; damit sich ihre Möglichkeiten erweitern, das Gelernte weiter anzuwenden und zu vertiefen. Also einen Ausbildungsplatz zu finden, sich weiter zu bilden und / oder in anderer angemessener Form ihr Leben aktiv zu gestalten. Dieser über den Abschluss hinausweisende Emanzipationsanspruch ist sowohl in der Verordnung über Nichtschülerprüfungen, wie auch in den Kerncurricula für die Hauptschule ausdrücklich formuliert. Die Grundlage hierfür schafft aber nicht der Abschluss an sich.
Auf dem Weg des „lebenslangen Lernens“, hin zum „mündigen Bürger“, der in seiner „Lebenswelt“ „emanzipiert“ ist in einer offenen „inklusiven“ Gesellschaft, ist der Hauptschulabschluss lediglich eine Etappe.
Die aussichtsreichste Perspektive, diese Etappe zu meistern, besteht eben in der Schaffung einer Grundlage, die über das Ziel Hauptschulabschluss hinausweist: Das Wissen darüber, wer wir als Mensch sind, wie wir uns als Individuum im gesellschaftlichen Gefüge orientieren, welche Rolle der Prozess des Lernens dabei spielt und wie der Mensch lernt. An dieser Stelle möchte ich an die konkreten Lernziele für die Hauptschulabschlussprüfung in folgenden Fächern erinnern:
- Biologie
- Politik
- Hauswirtschaft
1. Grundlegend, ganzheitlich und multiperspektivisch
Wenn man sich die in den Kerncurricula formulierten Bildungsbeiträge der einzelnen vorhergehend aufgeführten Fächer anschaut, liegt auf der Hand, dass gerade durch die zeitliche Begrenzung unserer Kurse ein fächerübergreifender, projektorientierter und sehr grundlegender Unterricht nicht nur erforderlich ist, um alle Themen abzudecken und den unterschiedlichen Leistungsstand der Teilnehmenden zu berücksichtigen, sondern auch förderlich ist, um den genannten Zielen möglichst nahe zu kommen.
Auch in Deutsch, im Umgang mit Sprachen im allgemeinen, sicher auch in Mathematik, ist eine grundlegende, ganzheitliche und multiperspektivische Herangehensweise in unseren Kursen möglich und konstruktiv. Grundlegend, sowohl, weil wir eine Grundlage schaffen müssen, auf der weiteres Lernen sich entwickeln kann, als auch, weil wir Grundlagen des Lernens vermitteln (wie kleines 1x1 oder das Alphabet, lesen, schreiben, rechnen …). Ganzheitlich, da wir alle Lebensbereiche der Teilnehmenden mehr oder weniger berühren, von Gesundheit und Hygiene, über den Umgang mit Menschen bis hin zu ökonomischen Fragen. Multiperspektivisch, da wir nicht nur aus der Perspektive der Lehrkraft den Kurs und den Prozess reflektieren, sondern auch gesellschaftliche Entwicklungen und persönliche Perspektiven der Teilnehmenden berücksichtigen müssen.
Zur Erinnerung: Diese Herangehensweise habe ich Anfangs als die Schaffung einer Grundlage, nämlich „Das Wissen darüber, wer wir als Mensch sind, wie wir uns als Individuum im gesellschaftlichen Gefüge orientieren, welche Rolle der Prozess des Lernens dabei spielt und wie der Mensch lernt“ beschrieben.
Und damit sind wir wieder beim Thema der „Befreiung“. Warum das Wissen über die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft „befreiendes“ Wissen ist, möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen, da es sich im weiteren Verlauf meiner Darstellung selbst erklärt. Was aber haben das Wissen über die Entwicklung der Menschheit und über den Prozess des Lernens mit Befreiung zu tun?
Abgesehen davon, dass es sich bei Lernerfolgen in unseren Kursen oft um die Überwindung – also die Befreiung - von Lernhemmnissen, Lernhindernissen und Lernstörungen, sowie die Befreiung von Ängsten und Druck handelt, handelt es sich bei einem grundlegenden, ganzheitlichen und multiperspektivischen Ansatz, wie zum Beispiel dem dialogischen Unterricht, auch um die Befreiung der Bildung an sich. Ist klassische (Erwachsenen-) Bildung meist zweckgerichtete, an bestimmten Institutionen (Gesellschaftliche Akteure, Branchen) und ihren Bedarfen ausgerichtete „Optimierungs- oder Zurichtungs-Bildung“, kann der befreiende Ansatz, der über das Lernziel hinaus weist, sich an den Bedürfnissen der Lernenden und ihren Emanzipationsbestrebungen orientieren. Auch der im dialogischen Unterricht sich entwickelnde Abbau von hierarchischen Strukturen ist befreiend für Lehrende und Lernende. Nicht zuletzt handelt es sich auch um Befreiungspädagogik, da Lernende bei Erfolg in die Lage versetzt werden, ihre soziale Rolle zu hinterfragen und sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen.
Durch das Wissen über die Entwicklung der Menschheit können sie die Vergangenheit verstehen und daraus lernen. Das ermöglicht den Teilnehmenden, die Ursprünge unserer Kultur, unserer Institutionen und unserer Gesellschaft zu verstehen.
Die Kenntnis der menschlichen Entwicklung hilft, die eigene Identität zu erkennen. Indem wir erfahren, wie unsere Vorfahren gelebt haben, welche Herausforderungen sie bewältigt haben und welche Errungenschaften sie erzielt haben, können wir uns besser mit unserer eigenen Geschichte und unseren Wurzeln verbinden. Dieses Verständnis kann uns ein Gefühl der Zugehörigkeit geben und helfen, uns als Teil einer größeren menschlichen Gemeinschaft zu sehen.
Gerade politische, soziale und ethische Fragen erfordern Wissen über vergangene Entwicklungen, um Antworten zu finden. Durch das Wissen über die Geschichte der Menschheit können wir die verschiedenen Formen der Unterdrückung und Diskriminierung erkennen, mit denen Menschen konfrontiert waren und immer noch sind. Indem wir die Ursprünge und Mechanismen dieser Unterdrückung verstehen, können wir uns bewusst dafür einsetzen, diese Muster zu durchbrechen und eine gerechtere und freiere Gesellschaft aufzubauen. Wissen ermöglicht es den Menschen, sich von Ignoranz und Vorurteilen zu befreien. Indem wir uns über verschiedene Aspekte der menschlichen Entwicklung informieren, können wir kritisch denken, eigene Entscheidungen treffen und unser eigenes Leben gestalten.
Bildung und Wissen geben den Menschen die Möglichkeit, unabhängig zu denken und sich aktiv an politischen, sozialen und kulturellen Prozessen zu beteiligen. Das Wissen über die Geschichte der Menschheit zeigt uns, dass es immer wieder Kämpfe für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte gegeben hat. Indem wir uns mit diesen Kämpfen und den Menschen, die sie geführt haben, vertraut machen, können wir uns inspirieren lassen und von ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit lernen.
Das Wissen um vergangene Befreiungsbewegungen kann uns ermutigen, uns für eine gerechtere Welt einzusetzen und uns gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Es zeigt uns, dass Veränderungen möglich sind. Es offenbart uns den Wandel von gesellschaftlichen Normen, politischen Systemen und sozialen Strukturen im Laufe der Zeit. Dieses Bewusstsein ermutigt uns dazu, bestehende Machtstrukturen zu hinterfragen und alternative Möglichkeiten zu erkunden, um eine gerechtere und freiere Gesellschaft zu schaffen. Der Prozess des Lernens ist ein komplexes Phänomen, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.
Die kritisch-pragmatistische Lerntheorie Peter Faulstichs, die sich mit dem Lernen Erwachsener in sozialen und politischen Kontexten befasst, betont die Bedeutung von Reflexion, Dialog und kritischem Denken bei erwachsenem Lernen. Gemäß Faulstich ist Lernen ein aktiver Prozess, bei dem individuelle Erfahrungen und soziale Interaktionen eine entscheidende Rolle spielen. Er argumentiert, dass Lernen in erster Linie in sozialen Praktiken und Zusammenhängen stattfindet und dass individuelle Lernprozesse eng mit gesellschaftlichen Strukturen und politischen Kontexten verbunden sind. Sich mit diesem Phänomen des Lernens als aktivem Prozess im sozialen Zusammenhang bewusst auseinanderzusetzen; zu erfahren, wie Lernen sich verändert und wie unsere soziale Rolle unseren Lernprozess- und Kontext beeinflusst, ist Bestandteil kritisch-pragmatischer, emanzipatorischer Praxis.
2. Warum Paulo Freire?
Paulo Freire war ein brasilianischer Pädagoge und Philosoph, dessen Werk im Bereich der Bildung durchaus einflussreich ist. Eines seiner bekanntesten Konzepte ist das "Alphabetisierungs-programm" oder die "alphabetisierende Methode" (auch bekannt als Freire'sche Methode oder kritische Alphabetisierung). Es gab bereits viele Entwicklungen in Richtung einer freien, offenen oder reformierten Pädagogik, warum also ausgerechnet die Konzepte eines christlich-marxistischen, politischen Pädagogen aus dem Südamerika des vergangenen Jahrhunderts aufgreifen? Der historische Kontext muss natürlich berücksichtigt werden und könnte gegen die Theorien Paulo Freires sprechen, ebenso sein politischer Anspruch: „Freire denkt eine revolutionäre Pädagogik, kritisiert politische Unterdrücker genauso wie dogmatische linke Führungspersonen, die er als Sektierer bezeichnet. Im Ende geht es ihm aber wie Karl Marx um eine Umkehrung der sozialen Verhältnisse, um eine umfassende Befreiung.“
Faschingeder, Gerald (2012): Radikal dialogisch. Reflexionen zum Globalen Lernen aus der Perspektive der Pädagogik Paulo Freires. In: Magazin erwachsenenbildung.at.
Der Unterricht im HSA-Bereich soll sich nicht in politische Kämpfe einmischen, sondern zielt darauf, mündige Menschen in ihrer Orientierungssuche zu stärken und mit Kompetenzen auszustatten, die gutes Handeln in einer komplexen Welt ermöglichen.
Das Alphabetisierungsprogramm von Paulo Freire basiert auf seinem Verständnis von Bildung als befreiender Praxis. Er betonte die Bedeutung der Ermächtigung von Menschen durch Bildung, um sie in die Lage zu versetzen, ihre eigene Realität zu verstehen und zu verändern. Das Programm wurde insbesondere in ländlichen Gemeinschaften in Brasilien eingesetzt, um Erwachsene zu alphabetisieren, die zuvor wenig oder gar keine formale Bildung erhalten hatten. Die Freire'sche Methode basiert auf der Idee, dass Bildung eine dialogische und partizipative Erfahrung sein sollte, bei der Lernende aktiv in den Lernprozess eingebunden sind. Anstatt einfach Informationen passiv aufzunehmen, werden die Lernenden ermutigt, ihre eigenen Erfahrungen, Kenntnisse und Perspektiven einzubringen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der sozialen und politischen Realität der Lernenden, um sie zu befähigen, ihre Situation zu analysieren, kritisch zu denken und Maßnahmen zur Verbesserung ihres Lebensumfelds zu ergreifen.
Die Alphabetisierung nach der Freire'schen Methode zielt nicht nur darauf ab, Grundlagen des Lesens und Schreibens zu vermitteln, sondern auch das Bewusstsein für soziale Ungleichheit zu schärfen, die Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu stärken und die Bürgerbeteiligung zu fördern. Indem die Lernenden ihre eigene Realität analysieren und in Diskussionen und Aktionen einbezogen werden, werden sie befähigt, ihre Stimmen zu erheben, sich für ihre Rechte einzusetzen und aktiv an der Transformation ihrer Gemeinschaften teilzunehmen. Paulo Freires Alphabetisierungsprogramm und seine kritische Pädagogik haben weltweit Anerkennung gefunden und wurden in verschiedenen Kontexten und Bildungsbereichen angewendet. Sein Werk hat einen bedeutenden Einfluss auf die Theorie und Praxis der Befreiungspädagogik und der kritischen Bildungstheorie gehabt. Paulo Freire machte seine ersten Alphabetisierungserfahrungen mit Landarbeitern, in der Regel Analphabeten, vom Wahlrecht ausgeschlossenen Personen, die in patriarchaler Unterdrückung um ihre Existenz kämpfen mussten. Auch hier ergeben sich Unterschiede zwischen unserer Ausgangssituation und dem Hintergrund Freirscher Theorien, die eine kritisch-pragmatische, emanzipatorische Lerntheorie selbstverständlich berücksichtigen muss.
Pädagogik war für Freire immer Dialog und Konflikt, sein Dialogverständnis war radikal: Der Dialog muss an die Wurzeln der Differenzen heranreichen, darf nicht oberflächlich sein. Und er muss radikal konsequent sein. Pädagogik als konflikthaftes Geschehen, als parteiliche Tätigkeit, als Ringen um Wahrheit und Gerechtigkeit: „Die Humanisierung war zwar in einem grundsätzlichen Sinne schon immer das Zentralproblem des Menschen – heute jedoch hat sie den Charakter einer unabweisbaren Fragestellung gewonnen“ (Freire 1973, S. 31). So lautet der erste Satz in der deutschsprachigen Ausgabe der „Pädagogik der Unterdrückten“. Interessant an dem Ansatz Paulo Freires ist für die kritisch-pragmatische, emanzipatorische Lerntheorie, dass er radikal den Dialog als Weg des wechselseitigen Lernens einfordert. Niemand weiß alles, aber niemand weiß nichts. Niemand befreit sich selbst, aber Befreiung geschieht wechselseitig, so Freire. Und so wie seine Landarbeiter sind auch unsere Teilnehmenden oft aus den Reihen der „Schwächsten der Schwachen“. Auch wenn es sich nicht um Analphabeten handelt, können Alphabetisierungskonzepte zur Stärkung der Lese- / Schreibkompetenzen genutzt werden. Einige Teilnehmende unserer Kurse sind aber auch funktionale Analphabeten. Auch das politische Bekenntnis, die „Haltung“, die Freire in der Pädagogik fordert, kann, unter Berücksichtigung aller Unterschiede in den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen, als Vorbild für eine aktuelle, befreiende Bildungspraxis dienen.
Die Idee einer „Befreiungs- statt Zurichtungs- Pädagogik“ ist angesichts der akuten Bildungskrise heute aktueller denn je. Ob man die „Verlorenheit“ und Orientierungslosigkeit unserer Teilnehmenden als (Folge einer) „Unterdrückung“ bezeichnen mag oder nicht: Die Sinnlosigkeit weisungsdidaktischer Erziehungsversuche gegenüber jungen Erwachsenen, an denen das Schulsystem bisher gescheitert ist, wird wahrscheinlich unumstritten sein. Die Tatsache, dass Erwachsene lernfähig, aber unbelehrbar sind, ist hinreichend bekannt. Am Ende dieses Kapitels möchte ich auch schon aktuelle Widersprüche ansprechen, die für Bildungsarbeit von Bedeutung sind: Bildung erlebt eine gesellschaftliche Transformation, die die vorhandenen Widersprüche verschärft. Tendenzen der Standardisierung von Bildung stehen im Widerspruch zu den Prozessen der Fragmentierung und Individualisierung. Mit künstlicher Intelligenz ist ein neuer Akteur erschienen, der die traditionellen Konzepte von Wissen und Bildung vor große Herausforderungen stellt, während viele Fragen, die sich aus einer seit über 50 Jahren laufenden Medienrevolution (Digitalisierung) ergeben, noch lange nicht beantwortet sind. Klimawandel und globale Krisen zwingen auch die Bildung zum Handeln.
Gleichzeitig haben krude Mythen und Verschwörungstheorien Hochkonjunktur und viele Menschen sind von der Informationsflut unzähliger medialer Angebote überfordert. Politik- und Biologieunterricht z.B. legt ein spezielles Augenmerk auf die politische Natur des Menschen als „homo politicus“. Die meisten Teilnehmenden unserer Kurse sind aber „politische Analphabeten“. Nachhaltigkeit und bewusster Konsum gehören zu den Lernzielen: Fairer Kaffee statt Coca Cola, faire Textilien statt teure Markenkleidung „shoppen“. Ist das schon Politik? Sowohl als auch. Aber beim fairen Konsum kann es nicht bleiben, Solidarität fordert mehr an Einsatz und Risiko. Ebenso notwendig ist das Entwerfen, Diskutieren und Praktizieren von neuen und alternativen Lebensentwürfen und Gesellschaftspraktiken. Wenn es ein „Weiter so“ nicht geben kann, ist gerade die Bildung aufgerufen, Menschen mit Kompetenzen zur Lösungsfindung auszustatten.
Und gerade hier setzt der dialogische Unterricht ja an: Mit der problemformulierenden Methode wird die Kritik des Ist-Zustandes aus Sicht der Betroffenen zum Ausgangspunkt des Lehr-Lernprozesses, der sich dialektisch zur Emanzipationsbestrebung entwickelt, welche Erkenntnisse zur Lösung konkreter Probleme (z.B. auch Erreichung des HS-Abschlusses) ermöglicht. Nun war plötzlich von Dialektik, statt von Dialog die Rede. Eine Verwechslung? Dialog und Dialektik sind nicht nur etymologisch verwandt, sie sind auch in Paulo Freires Theorien untrennbar miteinander verbunden. Dialog ist nicht beliebig, sondern geht von Standpunkten und Positionen aus. Diese Positionen sind aber nicht Ausdruck von dogmatischer Erstarrung, sondern stellen sich der Herausforderung, sich mit der eigenen Widersprüchlichkeit bewusst zu befassen. Das macht den Dialog dialektisch, so dass ein Lerndialog entsteht, in dem alle etwas lernen und jeder zum Lehrer des Anderen wird. Fremdbefreiung und Selbstbefreiung gehen Hand in Hand. Dialog, Radikalität und Dialektik scheinen mir brauchbare Beiträge aus der Pädagogik Paulo Freires für eine kritisch-pragmatische, emanzipatorische Lerntheorie und ihre Anwendung im HSA-Bereich zu sein. Zudem kann seine Alphabetisierungsmethode zur Stärkung der Lese- und Schreibkompetenzen eingesetzt werden.
3. Warum Kritik?
„Warum denn immer kritisieren und nicht einmal positiv denken?“, könnten einige fragen, wenn ich sage, die dialogische Methode baut auf einer Kritik oder einem Konflikt auf. Ausgangspunkt für dialogische Bildungsarbeit ist das reale Umfeld, mit der es ein Einzelner oder eine Gruppe zu tun hat. Dialog im Bildungsprozess beinhaltet deshalb immer die Berücksichtigung der Lernenden, ihre Einstellungen, ihr Alltagsbewusstsein, ihr thematisches Universum.
Nicht vorgegebene Curricula und erwartete Ergebnisse sind Inhalte eines dialogischen Bildungsprozesses, sondern die generativen Themen der Teilnehmenden. Dazu bedarf es der Moderation und Koordination, damit das Vertrauen in die eigenen Stärken der jeweiligen Schüler geweckt wird. Der dialogische Lernprozess vermittelt die Reflexion der eigenen Erkenntnis, des Wissens und Handelns und führt so zu selbständigem und selbstbewusstem Lernen. Probleme und Widersprüche, Brüche und Differenzen sind Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens und Gegenstand dialogischer Erörterung. Befreiende Pädagogik begreift sich als Reflexions- und Handlungsfeld zur Erweiterung persönlicher Kompetenzen in situativen Gegebenheiten.
Um das Interesse der Teilnehmenden am Lernprozess zu wecken, sind gerade Differenzen, Brüche, Widersprüche und Probleme – um nicht zu sagen gar Provokationen – im dialogischen Unterricht grundlegend. Erstens sind sie die Quelle der Lernhindernisse und Lernhemmnisse, welche ohnehin erörtert werden. Zweitens ist die Forderung „konstruktiver“ und „positiver“ Leistungen der Teilnehmenden am Anfang des dialogischen Prozesses eine zu hohe Hürde, da der Lernprozess ja eben erst die Voraussetzungen für eine „Bewusstwerdung“ (Freire) schafft. Die selbstbewusste Kritik des Ist-Zustandes aus der Sicht der Teilnehmenden allerdings, muss Ausgangspunkt dialogischen Unterrichts sein, damit das Bildungsanliegen ihr eigenes ist und Augenhöhe zur Lehrkraft hergestellt wird.
„Die Anwendung der von Freire als problemorientiertes Vorgehen bezeichneten Methode bedeutet, dass der Lehrer zum Lehrerschüler wird. Ebenso verliert der Schüler seine Rolle als Schüler und wird zum Schülerlehrer. Dieser neue wechselseitige pädagogische Bezug überwindet die unpolitsch-individualistische Begrenzung herkömmlicher Lernprozesse. Dem Wissensbegriff wird hiermit eine situationsbezogene Dimension hinzugefügt. Auch Unterrichtsabläufe werden in ihrer sterilen Vorausplanbarkeit hinfällig, weil herkömmliches Unterrichten die Lebens- und Handlungsmöglichkeiten der am Bildungsprozess Beteiligten verengt.“
Stangl, W. (2022). Dialog als grundlegendes Prinzip des Lernens in der Schule - Die Pädagogik Paulo Freires
4. Warum Peter Faulstich?
Peter Faulstichs „Menschliches Lernen“ ist eine umfassende Begründung seiner kritisch-pragmatistischen Lerntheorie. „Ausgehend von einer kritischen Reflexion vorliegender verhaltenswissenschaftlicher, kognitivistischer, konstruktivistischer und neurophysiologischer Modelle entwickelt Peter Faulstich eine kritisch-pragmatistische Lerntheorie, welche die Verkürzungen und Einseitigkeiten anderer Konzepte überwindet. Die Theorie menschlichen Lernens verbindet die Diskussion um Lerntheorien mit der Tradition des Bildungsbegriffs und umfasst Ansätze der Bildungswissenschaften, der Psychologie und der Soziologie.“ Klappentext Transcript Verlag zu Peter Faulstich, Menschliches Lernen, Eine kritisch-pragmatistische Lerntheorie Die Erweiterung um „emanzipatorisch“ soll keineswegs der kritisch-pragmatistischen Lerntheorie ihren emanzipatorischen Anspruch und Gehalt absprechen! Sie bringt lediglich zum Ausdruck, dass es sich bei der „kritisch-pragmatischen, emanzipatorischen Lerntheorie“ um ein anderes Modell handelt, welches sich zwar an Peter Faulstichs Lerntheorie orientiert, zusätzlich aber den Emanzipationsgedanken noch stärker in den Fokus rückt und sich daher von dem, bei Faulstich enthaltenen, „Deweyschen Pragmatismus“ distanziert.
5. … und was ist „kritisch pragmatisch“?
Die Frage lautet bewusst NICHT, was „kritischer Pragmatismus“ ist. Denn die kritisch-pragmatische, emanzipatorische Lerntheorie ist „pragmatisch“, aber auf keinen Fall „pragmatistisch“. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der „kritische Pragmatismus“, den Peter Faulstich in seiner Theorie aufgreift, ist erklärter Maßen ein Zugeständnis an konstruktivistische Sichtweisen und der Versuch, über Deweys „Pragmatismus“ eine Brücke zu diesen zu bauen. Diese „Anschlussfähigkeit an den vorherrschenden Diskurs“ (Faulstich) hat die kritisch-pragmatische, emanzipatorische Lerntheorie nicht nötig, da sie sich an Unterdrückte und nicht an den vorherrschenden Diskurs wendet.
Auf den kritischen Ansatz bin ich bereits ausführlich eingegangen. Pragmatisch steht bei der kritisch-pragmatischen, emanzipatorischen Lerntheorie vor allem für den Praxisbezug. Sie versucht weniger, den Prozess des Lernens zu erklären, was die pragmatistische Lerntheorie unter Rückgriff auf die Kritische Psychologie ja bereits geleistet hat, sondern eher die Gestaltungsmöglichkeiten des Lernprozesses, also die didaktische Ebene, sowie die praktische Umsetzbarkeit kritischer und emanzipatorischer Pädagogik zu beleuchten.
Paulo Freire wendet sich in seiner Pädagogik gegen jedes Dogma und gegen das Lehren als reine Technik, wobei er selbst in Teilen dogmatisch wird und auch Lehrtechnik vermittelt. Dieser Widerspruch entspringt der Praxis. Freire verweist darauf, dass den Landarbeitern erst die Vorteile des Lesens und Schreibens erklärt werden müssen, bevor die Alphabetisierung beginnen kann. Auch der dialogische Prozess wird mittels bestimmter Techniken gestartet. Solche Anpassungen der „reinen Theorie“ an die gegebenen Bedingungen praktischer Umsetzbarkeit, das ist der Kern des Pragmatischen bei der kritisch-pragmatischen, emanzipatorischen Lerntheorie. Bei der praktischen Anwendung der kritisch-pragmatischen, emanzipatorischen Lerntheorie resultiert das Pragmatische einerseits aus der Orientierung an der Kritik des Ist-Zustandes durch die Teilnehmenden im dialogischen Prozess. In der Praxis stellt diese bereits einen pragmatischen Umgang mit den individuellen Herausforderungen der Teilnehmenden dar: Die Ursachen bisheriger Lernhindernisse werden zum Ausgangspunkt der Bewusstwerdung und des Lernprozesses. Zum Anderen ergibt sich das Pragmatische in der Praxis aus dem konkreten Ziel der Erreichung des HS-Abschlusses, welches den dialogischen (Lern-) Prozess in das „Praxisprojekt Teilnahme an der Nichtschülerprüfung“ einbettet. Pragmatisch ist auch die Niedrigschwelligkeit des Angebots, das größtmögliche Entgegenkommen unter Berücksichtigung Ihrer Lebenssituation gegenüber den Teilnehmenden, da die Möglichkeit Lernprozesse zu initiieren und Grundkompetenzen zu vermitteln, bei freiwilliger Teilnahme der Lernenden, höher geschätzt wird, als formelle Zuverlässigkeit, Disziplin und Leistungsnachweise.
6. Offener dialogischer Unterricht im HSA-Bereich
Nichtsdestotrotz müssen wir, um den organisatorischen Rahmen aufrecht zu erhalten und einen erfolgreichen Kursverlauf zu garantieren, eine gewisse Stabilität der Teilnahme und Verbindlichkeit im Verhalten der Teilnehmenden erreichen. Da Sanktionsmöglichkeiten bei jungen Erwachsenen, die freiwillig einen Kurs besuchen, ohnehin begrenzt sind, ist es zwingend erforderlich, eigenverantwortliches Handeln und die Lernmotivation der Teilnehmenden zu stärken. Der offene, dialogische Unterricht stellt daher die „Mündigkeit“ der Teilnehmenden und ihre Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln unbedingt an den Anfang der Kurssituation.
Zwar machen die Fluktuation und Wechselhaftigkeit der aktiven Teilnahme in unseren Kursen feste Lehrpläne und langfristige Unterrichtsplanung wenig effektiv. Doch die Praxis hat gezeigt, dass Fluktuation in den Kursen und Unzuverlässigkeiten in der Teilnahme sogar deutlich abnehmen, je mehr Eigenverantwortung den Teilnehmenden zugestanden wird. Offener Unterricht bedeutet zudem, nicht nur aktuelle Entwicklungen und gesellschaftliche Debatten, sondern auch die Themen der Teilnehmenden und ihre Tagesform in den Unterricht aufzunehmen. Das ist bei starrer Planung fast unmöglich. Die dialogische Methode dagegen ermöglicht einen offenen Unterricht, der die Sichtweisen der Teilnehmenden in den Mittelpunkt stellt. Dabei hat die Lehrkraft die Aufgaben, den Rahmen zur Verfügung zu stellen, den Dialog zu initiieren und zu moderieren, sowie aktiv am Dialog teilzunehmen. Hierzu kann die Moderatorenrolle auch vorübergehend abgegeben werden. Im Dialog ergeben sich Lern- und „Forschungs-“ / Recherche-Aufträge an alle Beteiligten, die wechselseitig eingefordert werden. Durch die Initiatoren- und Moderatorenrolle ist es der Lehrkraft möglich, die didaktisch ergiebigen bzw. prüfungsrelevanten Fragestellungen der Themenkomplexe, welche sich aus den Lernanliegen der Teilnehmenden ergeben, herauszustellen und den Teilnehmenden plausibel zu machen. So gestaltet sich ein gruppendynamischer Lehr-Lern-Prozess, in dessen Verlauf die Anforderungen der Abschlussprüfung transparent und in den jeweiligen persönlichen Kontext der Teilnehmenden gestellt werden.
Die Anwendung der Freirschen Alphabetisierungsmethode im offenen dialogischen Unterricht kann zum Beispiel im Fach Deutsch folgendermaßen aussehen: Zum Kursbeginn sammeln die Teilnehmenden Wörter, die ihre Lebenswirklichkeit und ihren Begriff von Sprache und Gesellschaft widerspiegeln. Es gibt verschiedene Methoden, die gut geeignet sind, die Sammlung zu initiieren: „10 Dinge die nerven“, „10 Begriffe, die mit meinem Hobby zu tun haben“, „10 Dinge die ich liebe“, „10 Dinge, die mit Politik zu tun haben“ usw. Die Liste dieser „generativen Wörter“ wird im Kursverlauf ergänzt, aber auch abgearbeitet. Immer wenn es, je nach Zusammensetzung der Gruppe und tagesaktueller Thematik, passt, werden Wörter von der Liste herangezogen und wie bei Freire kodiert und dekodiert. Hinzu kommen die Begriffe, die im Zusammenhang mit den Unterrichtsthemen des Tages bekannt sein müssen. Die Kodierung kann z.B. durch Bilder, durch kurze Dokumentationen oder Videoclips erfolgen. Es „entsteht“ ein komplexes und kontroverses „generatives Thema“, welches besprochen wird. Dann erfolgt die Dekodierung, indem der Dialog auf das ursprüngliche generative Wort zurück geführt wird. Das Wort wird zunächst grammatikalisch, semantisch und etymologisch untersucht. Sodann werden Antonyme, Synonyme und verwandte Wörter gesammelt und ebenfalls genauer betrachtet. Anschließend werden Sätze gebildet, kleine Aufsätze geschrieben und Texte gelesen, in denen die bearbeiteten Begriffe relevant sind. Durch die Kodierung und Dekodierung sind die Wörter „vertraut“ und ihre Bedeutung in Themenkomplexe aus Sicht der Teilnehmenden eingebunden. Damit ist das Wort verstanden, in den mündlichen und schriftlichen Wortschatz integriert und wird nicht mehr vergessen. Meist gilt dies auch für die korrekte Rechtschreibung. Eine Vielzahl von Themen lässt sich ableiten, es ist möglich den Assoziationen der Teilnehmenden zu folgen und auf ihre Fragen einzugehen, aber auch eigene Themen einzubringen oder prüfungsrelevante Themenfelder herauszustellen.
Dieses bleibt dann selbstverständlich nicht auf das Fach Deutsch beschränkt, sondern betrifft alle Fächer, in denen die generativen Begriffe / Themen bearbeitet werden können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein offener Unterricht im HSA-Bereich, der sich an den curricularen Themen und den Themen der Teilnehmenden orientiert, Konflikte und Widersprüche in dialogischen Lehrsituationen multiperspektivisch und fächerübergreifend bearbeitet und die Mündigkeit der Teilnehmenden an den Anfang stellt, geeignet ist, einen Bildungsbeitrag im Sinne emanzipatorischer Pädagogik zu leisten.
Weitere Überlegungen zum Thema:
Der Freiheitsbegriff in der Philosophie ...
- bei Immanuel Kant
- bei Karl Marx
- bei Rosa Luxemburg
- bei Hannah Ahrendt
... und in der kritischen Psychologie